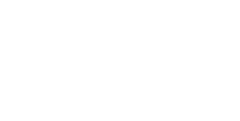Mit seinem Gutachten vom 23. Juli 2025 hat der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag festgestellt: Der Klimawandel ist nicht nur eine globale Krise, sondern eine rechtliche Herausforderung. Staaten sind völkerrechtlich verpflichtet, Klimaschäden zu verhindern und gemeinsam wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Der IGH erkennt das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt als Menschenrecht an.
Initiative aus dem Pazifikraum
Den Anstoß für das Verfahren gab der besonders vom Klimawandel betroffene Inselstaat Vanuatu. Unterstützt von der Studierendenbewegung „Pacific Islands Students Fighting Climate Change“, stellte Vanuatu 2023 bei der UN-Vollversammlung den Antrag, den IGH um eine gutachterliche Stellungnahme zu völkerrechtlichen Verpflichtungen im Klimaschutz zu ersuchen. Ziel war es, Klarheit über die Verantwortung von Staaten gegenüber besonders gefährdeten Regionen zu schaffen.
Klimaschutz ist völkerrechtliche Pflicht
Der IGH stellt fest: Die globale Erwärmung ist eine existenzielle Bedrohung, der alle Staaten verpflichtet sind entgegenzuwirken. Das Gericht betont die Pflicht zur Zusammenarbeit und zur Umsetzung effektiver Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels.
Auch außerhalb spezieller Klimaabkommen wie dem Pariser Abkommen oder dem Kyoto-Protokoll gelten diese Pflichten. Denn das sogenannte Völkergewohnheitsrecht – also ungeschriebene, aber allgemein anerkannte Regeln – verpflichtet Staaten, erhebliche Umweltschäden zu vermeiden.
Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt
Besonders weitreichend ist die rechtliche Anerkennung einer intakten Umwelt als grundlegendes Menschenrecht. Dieses sei Voraussetzung für die Ausübung anderer Rechte wie Leben, Gesundheit oder persönliche Sicherheit. Damit verankert der IGH den Umweltschutz direkt in den menschenrechtlichen Rahmen.
Industriestaaten besonders in der Pflicht
Das Gutachten nimmt insbesondere die Industrieländer in die Verantwortung. Sie sollen ihre Emissionen senken, ihre CO₂-Senken ausbauen und eine Führungsrolle im Klimaschutz übernehmen. Das Versäumnis, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, kann als völkerrechtswidrige Handlung bewertet werden, unabhängig davon, ob ein Staat Teil eines Klimaabkommens ist. Ein Rückzug aus der Verantwortung, etwa durch Austritt, ist somit ausgeschlossen.
Rechtliche Folgen bei Verstößen
Für Staaten, die ihre Pflichten verletzen, nennt der IGH drei mögliche Konsequenzen:
- Einstellung des völkerrechtswidrigen Verhaltens,
- Garantie, es nicht zu wiederholen,
- Wiedergutmachung – etwa in Form von Entschädigungen.
Voraussetzung dafür ist ein Kausalzusammenhang zwischen Handlung und Schaden. Damit eröffnet das Gutachten einen schwierigen, aber möglichen Klageweg insbesondere für kleine, geschädigte Staaten wie Vanuatu gegenüber großen Emittenten.
Globale Signalwirkung – auch für nationale Gerichte
Obwohl das IGH-Gutachten formal nicht bindend ist, hat es politisches und juristisches Gewicht. Es wird als Referenz für nationale Gerichte und Klimaklagen dienen – auch in Deutschland, etwa im aktuellen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zum Klimaschutzgesetz. Insgesamt schafft der IGH mit seinem Gutachten eine neue rechtliche Grundlage, die Klimapolitik über das Pariser Abkommen hinaus verankert und deutlich macht: Klimaschutz ist keine freiwillige Aufgabe, sondern eine völkerrechtliche Verpflichtung.
(Quelle: DIHK)